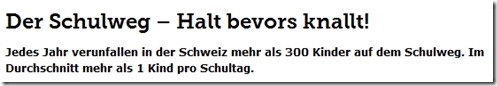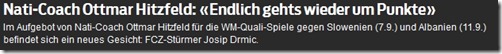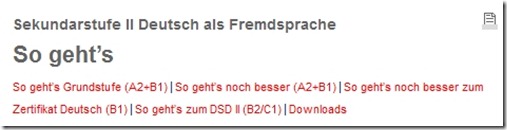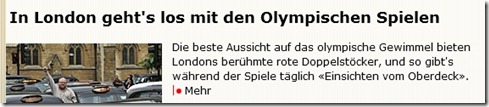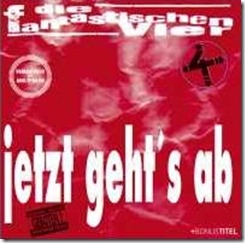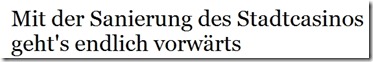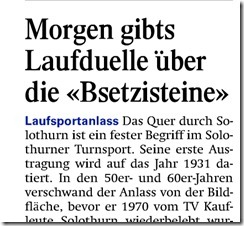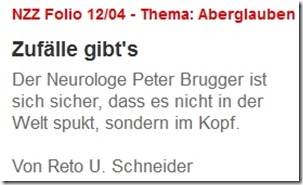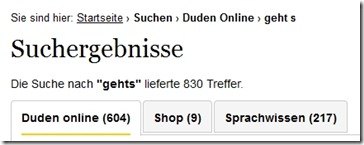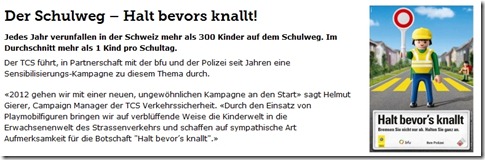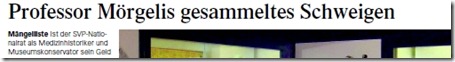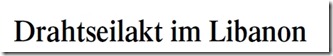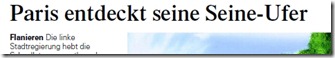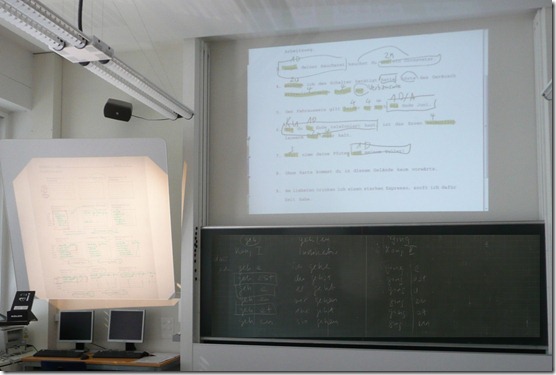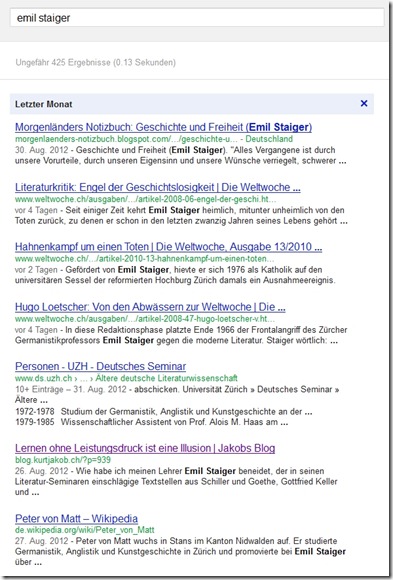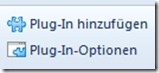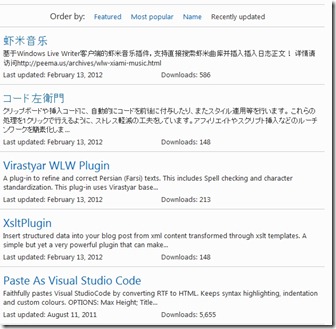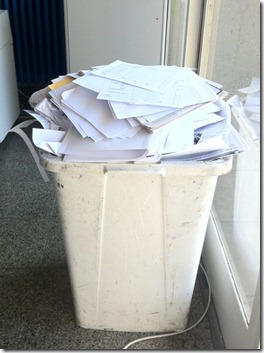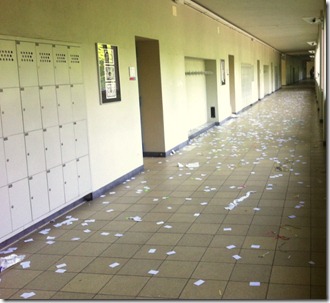Seit einiger Zeit können wir in der Schweiz die folgenden Plakate am Straßenrand lesen
Auf der TCS-Webseite allerdings lesen wir dann
Was stimmt nun?
Ein Blick auf eine andere Wendung bringt vielleicht Klarheit:
Im Blich sagt etwa der Nazi-Coach Ottmar Hitzfeld
Auf der Seite des Klett-Verlages allerdings lesen wir:
Im 20Minuten allerdings steht
Auf der Seite von DRS 1 wiederum lesen wir
In der Berner Zeitung hingegen lesen wir
Anders sehen es wiederum die Fantastischen Vier
Anders sieht das “Der Bund”
Und in der Handelszeitung
Und auch in der Solothurner Zeitung steht
Ähnlich chaotisch sieht es im Fall von gibts oder gibt’s aus
So lesen wir in der Solothurner Zeitung vom Donnerstag, 6.9.2012, S. 25
Im Apple-Store hingegen lesen wir
Auch im NZZ Folio lesen wir
Und was meint der Duden zu all dem?
Der folgende Suchauftrag nach “geht’s”
führt im Duden online zu folgenden Ergebnissen
Meine Schreibweise wird also einfach ignoriert, auch Anführungszeichen nützen nichts, der Duden korrigiert ganz konsequent “geht’s” in “gehts”.
Im Duden Rechtschreibung stößt man dann auf die folgende Regel:
Bei umgangssprachlichen Verbindungen eines Verbs oder einer Konjunktion mit dem Pronomen es ist der Apostroph entbehrlich; er wird jedoch häufig verwendet.
– Wie gehts (auch: geht’s) dir?
– Nimms (auch: Nimm’s) nicht so schwer.
– Wenns (auch: Wenn’s) weiter nichts ist …
(Duden – Die deutsche Rechtschreibung, 25. Aufl. Mannheim 2009)