In einem guten Satz steckt mehr als in einem schlechten Buch.
Quelle: SZ-Kolumne: Was lesen Sie, Robert Seethaler? – Kultur – SZ.de
Dies und das
In einem guten Satz steckt mehr als in einem schlechten Buch.
Quelle: SZ-Kolumne: Was lesen Sie, Robert Seethaler? – Kultur – SZ.de
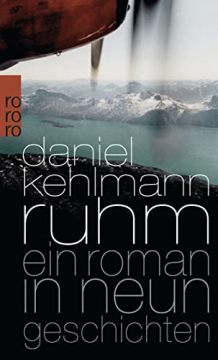 Ruhm. Ein Roman in neun Geschichten
Ruhm. Ein Roman in neun Geschichten
Ein Schriftsteller mit der unheilvollen Neigung, Menschen, die ihm nahestehen, zu Literatur zu machen, ein verwirrter Internetblogger, ein Abteilungsleiter mit Doppelleben, ein berühmter Schauspieler, der lieber unbekannt wäre, eine alte Dame auf der Reise in den Tod: Ihre Wege kreuzen sich in einem Geflecht von Episoden zwischen Wirklichkeit und Schein. Ein Spiegelkabinett voll unvorhersehbarer Wendungen– komisch, tiefgründig und elegant erzählt vom Autor der 'Vermessung der Welt'.
Ausnahmsweise lese ich mit mehr als einer Klasse das gleiche Buch. Der „Roman in neun Geschichten“ besteht also aus neun Erzählungen, die inhaltlich lose, thematisch aber stärker miteinander verbunden sind. Einmal mehr sind die Meinungen zu diesem Buch recht gespalten. Einige wenige finden es wirklich gut, die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler hat aber Schwierigkeiten damit. Das Spiel mit Wirklichkeiten macht ihnen Mühe oder es interessiert sie ganz einfach nicht. Vielleicht werde ich ja noch mehr Begeisterung hervorrufen können.
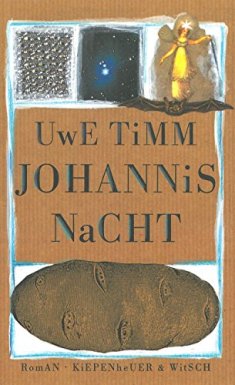 Johannisnacht
Johannisnacht

Einen Artikel über die Geschichte der Kartoffel soll er schreiben - und entsprechendes Material vermutet der Erzähler aus München in Berlin. Drei tolle Tage und Nächte warten hier auf ihn - um die Mittsommernacht, als Christo den Reichstag verhüllt. Von West nach Ost, quer durch alle Schichten und Szenen führen ihn seine Recherchen, mit Tuaregs und Technomädchen, Waffenhändlern und Friseuren kommt er in Verbindung und gerät in eine aberwitzige Folge von Verwicklungen und Abenteuern.
Eine witzige Geschichte, die in Berlin nach der Wende spielt und die so nebenbei auch einiges aus der Vergangenheit dieser Stadt offenbart. Uwe Timm zeigt hier eine Freude am Fabulieren, die auf Leser ansteckend wirken kann. Ich lese das Buch im Moment mit einer Schulklasse. Die Schülerinnen und Schüler sind manchmal durch die scheinbar wirre Handlungsführung allerdings etwas irritiert, zugleich aber auch fasziniert. Zunehmend beginnen sie Leitmotive zu erkennen und zu deuten. Oft allerdings bin ich der einzige, der die wirren Sachen lustig findet.
Uwe Timm gehört zu meinen Lieblingsautoren. Ich mag diese Fabulierfreude und die manchmal absurd scheinenden Geschichten, die auf einer höheren – oder tieferen – Ebene plötzlich in neue Sinnzusammenhänge gebracht werden können. So habe ich mit der Klasse bisher die Kreis- und Ringsymbolik genauer angeschaut und den Zusammenhang zur Odysee-Thematik hergestellt.
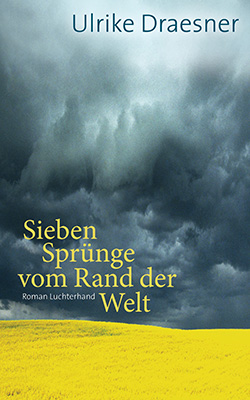 Sieben Sprünge vom Rand der Welt
Sieben Sprünge vom Rand der Welt
Was es bedeutet, die Heimat zu verlieren.
Ulrike Draesner kreuzt die Lebenswege der schlesischen Grolmanns mit dem Schicksal einer aus Ostpolen nach Wroclaw vertriebenen Familie. Vier Generationen kommen zu Wort. Virtuos entwirft der Roman ein Kaleidoskop der Erinnerungen, die sich zu immer neuen Bildern fügen. Sie zeigen, wie durch Zwangsmigration zugefügte Traumata sich auswirken, wie seelische Landschaften sich von einer Generation in die nächste weiterstempeln. Die Geschichten der Grolmanns und der Nienaltowskis werden zum Spiegel von hundert Jahren mitteleuropäischer Geschichte. Mitreißend und poetisch erzählt die Autorin von den Mühen und Seligkeiten der Liebe zwischen Eltern und Kindern, von Luftwurzeln, Freiheit und Migration.
Autorentext
Ulrike Draesner, 1962 in München geboren, lebt in Berlin und Leipzig. Sie schreibt Romane, Erzählungen, Essays und Gedichte und interessiert sich für Naturwissenschaften ebenso wie für kulturelle Debatten. Für ihre Romane und Gedichte wurde Ulrike Draesner mehrfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Bayerischen Buchpreis, dem Deutschen Preis für Nature Writing, dem Preis der LiteraTour Nord, dem Ida-Dehmel-Literaturpreis (alle 2020), dem Gertrud-Kolmar-Preis (2019) und dem Nicolas-Born-Preis (2016). Von 2015 bis 2017 lehrte sie an der Universität Oxford, seit April 2018 ist sie Professorin am Deutschen Literaturinstitut Leipzig. »Ulrike Draesner ist eine der bedeutendsten deutschen Schriftstellerinnen der Gegenwart. Als Romanautorin, Lyrikerin, Essayistin und Übersetzerin besonders erwähnenswert sind ihre Übersetzungen der diesjährigen Nobelpreisträgerin Louise Glück ins Deutsche , hat sie breite Anerkennung erlangt.« Times Literary Supplement
Wie auf der Seite des Deutschlandfunks zu lesen ist, erhält Rachel Salamander den mit 50’000 Euro dotierten Heine-Preis. Salamander ist die Tochter von Holocaust-Überlebenden, studiert hat sie in München Germanistik, Philosophie und Romanistik.
Nach dem Studium hat sie keine akademische Karriere angestrebt, sondern eine Buchhandlung eröffnet,
ein Buchgeschäft, das sich ganz der jüdischen Literatur und Kultur widmete, eröffnete. Sondern auch, dass sie diese zu einem Ort machte, an dem gelesen, diskutiert und debattiert wurde, war damals etwas Außergewöhnliches, ein Novum. Lesungen von Schriftstellern, wie sie heute alltäglich sind, waren zu der Zeit noch eine absolute Seltenheit, doch Salamander brachte in ihrem Buchladen die Menschen zusammen und Debatten in Gang.
Amos Oz, Zeruya Shalev, David Grossman, Micha Brumlik, Maxim Biller, Dan Diner und viele mehr traten bei ihr auf, und immer wieder auch Marcel Reich-Ranicki. Vor allem aber machte Salamander jüdisches Leben in Deutschland wieder sichtbar. Sie selbst spricht von einer „ersten Rekonstruktionsarbeit“. „All die, die vertrieben und ermordet worden sind, wieder in Deutschland zu beheimaten“: So beschreibt Salamander, was sie angetrieben hat, die Literaturhandlung ins Leben zu rufen, mit Leben zu füllen.
Quelle: FAZ.net
Sie wurde mit vielen Preisen geehrt, etwa mit dem Kulturellen Ehrenpreis von München, mit dem Bundesverdienstkreuz und dem Schillerpreis, in diesem Jahr wird sie also mit dem Heinrich-Heine-Preis der Stadt Düsseldorf ausgezeichnet
Ein interessantes Gespräch mit ihr im Deutschlandfunk findet man hier.
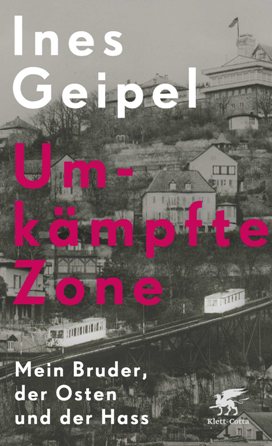 Umkämpfte Zone
Umkämpfte Zone
Woher kommt die große Wut im Osten? Fremdenfeindlichkeit und Hass auf »den Staat«: Verlieren wir den Osten Deutschlands? Das Buch sucht Antworten auf das Warum der Radikalisierung, ohne die aktuell bestimmende Opfererzählung nach 1989 zu bedienen. Es erzählt von den Schweigegeboten nach dem Ende der NS-Zeit, der Geschichtsklitterung der DDR und den politischen Umschreibungen nach der deutschen Einheit. Verdrängung und Verleugnung prägen die Gesellschaft bis ins Private hinein, wie die Autorin mit der eigenen Familiengeschichte eindrucksvoll erzählt. »Ein wirklich grandioses Buch. Kein Wort zu viel und jeder einzelne Satz ein Volltreffer. Eins der wichtigsten Bücher des Jahres.« Markus Lanz, ZDF - Markus Lanz, 11.04.2019
Zur Autorin:
Ines Geipel, geboren 1960, ist Schriftstellerin und Professorin für Verskunst an der Berliner Hochschule für Schauspielkunst »Ernst Busch«. Die ehemalige Weltklasse-Sprinterin floh 1989 nach ihrem Germanistik-Studium aus Jena nach Westdeutschland und studierte in Darmstadt Philosophie und Soziologie. Sie lebt in Berlin und hat vielfach zu Themen der Geschichte des Ostens publiziert.
Klappentext:
Fremdenfeindlichkeit und Hass auf »den Staat«: Verlieren wir den Osten Deutschlands? Das Buch sucht Antworten auf das Warum der Radikalisierung, ohne die aktuell bestimmende Opfererzählung nach 1989 zu bedienen. Es erzählt von den Schweigegeboten nach dem Ende der NS-Zeit, der Geschichtsklitterung der DDR und den politischen Umschreibungen nach der deutschen Einheit. Verdrängung und Verleugnung prägen die Gesellschaft bis ins Private hinein, wie die Autorin mit der eigenen Familiengeschichte eindrucksvoll erzählt. Seit 2015 haben sich die politischen Koordinaten unseres Landes stark verändert – insbesondere im Osten Deutschlands. Was hat die breite Zustimmung zu Pegida, AfD und rechtsextremem Gedankengut möglich gemacht? Ines Geipel folgt den politischen Mythenbildungen des neu gegründeten DDR-Staates, seinen Schweigegeboten, Lügen und seinem Angstsystem, das alles ideologisch Unpassende harsch attackierte. Seriöse Vergangenheitsbewältigung konnte unter diesen Umständen nicht stattfinden. Vielmehr wurde eine gezielte Vergessenspolitik wirksam, die sich auch in den Familien spiegelte – paradigmatisch sichtbar in der Familiengeschichte der Autorin. Gemeinsam mit ihrem Bruder, den sie in seinen letzten Lebenswochen begleitete, steigt Ines Geipel in die »Krypta der Familie« hinab. Verdrängtes und Verleugnetes in der Familie korrespondiert mit dem kollektiven Gedächtnisverlust. Die Spuren führen zu unserer nationalen Krise in Deutschland.
Quellen: Klett-Cotta, Ex-Libris
Seit 1981 wird der der Marieluise-Fleisser-Preis zum Gedenken an Marieluise Fleisser von der Stadt Ingolstadt vergeben, seit 2001 jedes zweite Jahr. Die Übergabe des Preises erfolgt jeweils am 23. November, dem Geburtstag von Fleisser. Seit 2002 ist der Preis mit 10’000 Euro dotiert. Mit der Übernahme des Archivs von Marie-Luise Fleissner entstand für Ingolstadt die Verpflichtung zur Vergabe dieses Preises.
Der „Marieluise-Fleißer-Preis“ dient der Förderung deutschsprachiger Autorinnen und Autoren, die – wie im Werk der Marieluise Fleißer – den Konflikt zwischen unerfüllten Glücksansprüchen und alltäglichen Lebenswelten zum zentralen Thema haben.
In diesem Jahr also erhält Ines Geipel den Preis, dies hat der Stadtrat am 29. Juli beschlossen.
Zu Ines Geissler lesen wir auf buchmarkt.de:
Ines Geipel, 1960 in Dresden geboren, studierte nach Abbruch ihrer Spitzensport-Karriere bis zu ihrer Flucht aus der DDR im Sommer 1989 Germanistik in Jena, danach Philosophie in Darmstadt. Seit 1996 ist sie Schriftstellerin und lehrt Verskunst an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch, Berlin.
Die politisch engagierte Autorin und Publizistin hat mehr als zwanzig Bücher und Essays verfasst. Ihr jüngstes Buch Umkämpfte Zone. Mein Bruder, der Osten und der Hass (2019) schildert die gegenwärtige Entwicklung der Situation in Ostdeutschland. In ihren Werken setzt sich Ines Geipel mit ihren prägenden Erfahrungen in der DDR auseinander.
Für ihre schriftstellerische Tätigkeit und ihr gesellschaftspolitisches Engagement bekam sie unter anderem folgende Auszeichnungen: den Antiquaria-Preis für Buchkultur (2011), den Karl-Wilhelm-Fricke-Preis als Sonderpreis (2019) sowie den Lessing-Preis für Kritik (2020).
2011 erhielt sie für ihr schriftstellerisches und politisches Engagement das Bundesverdienstkreuz.
In ihrem neusten Werk “Umkämpfte Zone”, das im Jahr 2019 erschienen ist, schildert sie die gegenwärtige Entwicklung der Situation in Ostdeutschland.
Der diesjährige Clemens-Brentano-Preis geht an den österreichischen Schriftsteller Simon Sailer für seine Werk Die Schrift. Die Jury begründete die Wahl wie folgt:
Ein Ägyptologe erhält eine rätselhafte, aber faszinierende Schrift, die sein Leben immer mehr aus der Bahn wirft. Mit Elementen der Hoch- und Popkultur spielend, entwickelt Simon Sailer in subtil-packendem Erzählton ein cineastisches Leseerlebnis: „Die Schrift“ handelt von der Macht der Zeichen sowie dem Horror, Opfer einer höheren Instanz zu werden. So entsteht, ergänzt durch anspielungsreiche Illustrationen, eine so vielfältige wie doppelbödige Erzählung. Sie ist Thriller und Novelle in einem.
Die Preisverleihung wurde wegen der Corona-Pandemie vom 19. Mai auf den 21. Juli verschoben, er wird in der Stadtbücherei Heidelberg übergeben und ist als Veranstaltung vor Ort und als Livestream geplant.
Der Clemens-Brentano-Preis ist mit 10’000 Euro dotiert und wurde 1993 von der Stadt Heidelberg gestiftet und wird seit 1995 jährlich verliehen. Die Jury besteht aus professionellen Literaturkritikerinnen und –kritikern sowie aus Studierenden des Germanistischen Seminars der Universität Heidelberg. Der Preis wird “im Wechsel in den Sparten Erzählung, Essay, Roman und Lyrik an Nachwuchs-Autoren verliehen, die mit ihren Erstlingswerken bereits die Aufmerksamkeit der Kritik und des Lesepublikums auf sich gelenkt haben”, so die offizielle Homepage. 2019 ist der Preis an Gianna Molinari für ihren Debüt-Roman Hier ist noch alles möglich verliehen worden.
Die Stadt benannte den Preis nach Clemens Brentano, der einige Zeit in Heidelberg gelebt hat. Er hielt sich ab 1804 kurze Zeit in Heidelberg auf, wo er mit Arnim die Zeitung für Einsiedler und die Gedichtsammlung Des Knaben Wunderhorn herausgab.